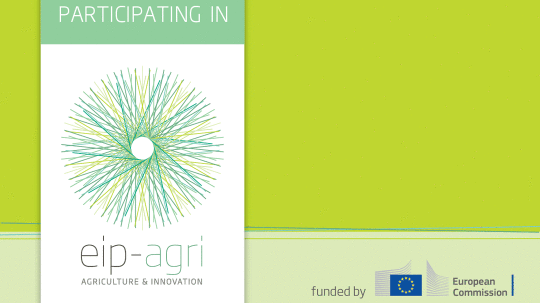Forschung und Innovation
Bayern will Innovation statt Stillstand. Daher fördert das Staatsministerium vielfältige anwendungsorientierte Forschung zu Zukunftsthemen im land- und forstwirtschaftlichen Bereich. Die Forschungseinrichtungen des Staatsministeriums decken ein weites Themenspektrum von Landwirtschaft, Ernährung, Forstwirtschaft, Gartenbau bis hin zu nachwachsenden Rohstoffen ab.
 © Birgit Gleixner, LfL
© Birgit Gleixner, LfL