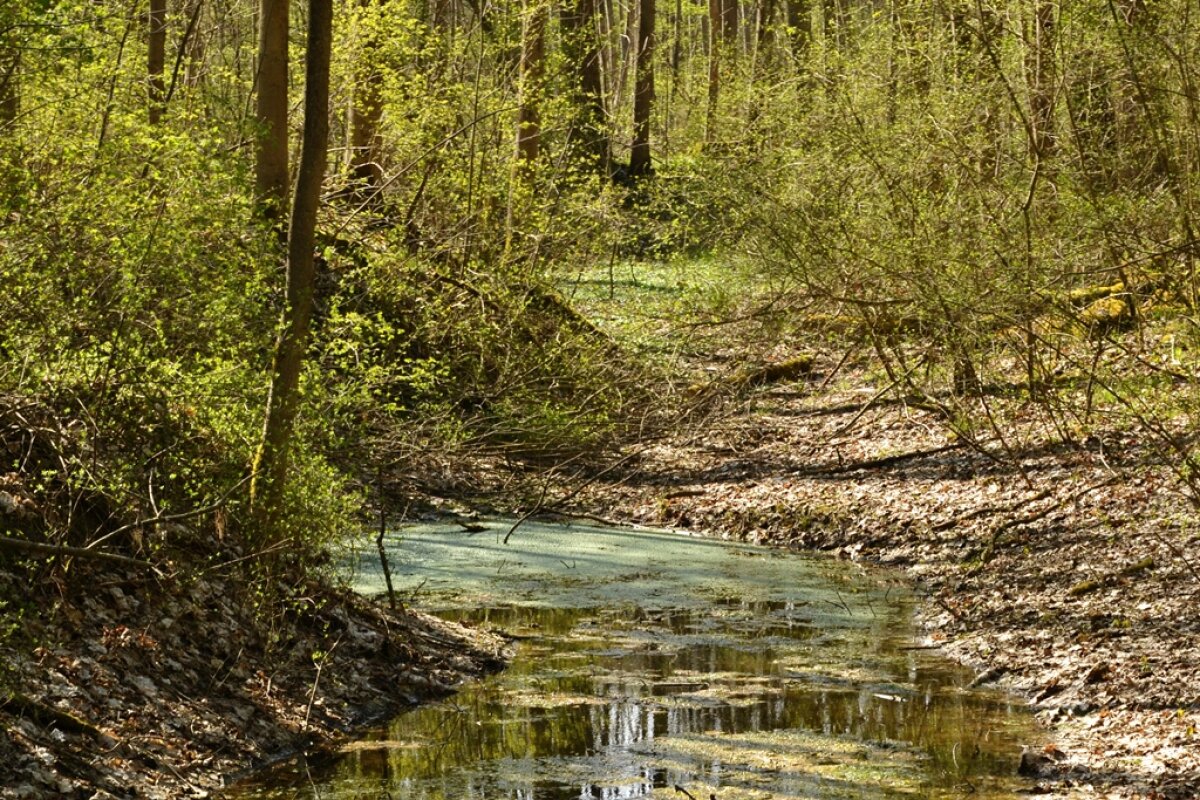Der Berg- und Schutzwald in den bayerischen Alpen
Ungefähr die Hälfte - also rund 260.000 Hektar - der bayerischen Alpen sind mit Wald bedeckt. Bergwälder bieten den Menschen und der Infrastruktur im bayerischen Alpenraum einen wirksamen Schutz vor Naturgefahren wie Steinschlag, Muren, Hangrutschungen oder Lawinen. Sie schützen den Boden aber auch vor Erosion, haben eine besondere Bedeutung für den Hochwasserschutz und spenden sauberes Trinkwasser. Gleichzeitig liefern sie den nachwachsenden Rohstoff Holz. Gäste aus nah und fern finden dort Erholung und Ausgleich. Die seit Jahren steigenden Besucherzahlen zeigen, dass die Alpen und ihre Wälder für die Freizeitgestaltung zunehmend attraktiver werden. Überdies gibt es in den bayerischen Alpen große zusammenhängende und naturschutzfachlich besonders wertvolle Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen.

Im Alpenraum erwarten Experten weitaus spürbarere Auswirkungen des Klimawandels als im übrigen Bayern. Vor allem die Erwärmung schreitet dort schneller voran und wird sich auf den Wald und dessen Baumartenzusammensetzung auswirken. Gleichzeitig stellen vorhergesagte häufigere Starkniederschläge hohe Anforderungen an die Bergwälder. Die Stabilisierung der Wälder und die natürliche Regulierung des Wasserabflusses werden an Bedeutung gewinnen.
Bergwaldoffensive
Die Anpassung der Bergwälder an den Klimawandel und der Erhalt ihrer Schutzfunktionen stellen gerade im oft kleinflächig strukturierten Privat- und Körperschaftswald die Eigentümer vor besondere Herausforderungen. Aus diesem Grund hat die Bayerische Staatsregierung bereits 2008 im Rahmen des Klimaprogramms die Bergwaldoffensive (BWO) ins Leben gerufen. Sie unterstützt mit einem gezielten Maßnahmenbündel die privaten und kommunalen Waldbesitzer bei ihrem Bemühen, den Bergwald für den Klimawandel fit zu machen. Waldbesitzer, Jäger, Naturschützer, Almbauern, Tourismusverbände bis hin zu den Kommunen erarbeiten gemeinsam vor Ort angepasste Lösungsansätze insbesondere in den Bereichen Waldpflege, Wegebau, Jagdmanagement, Biotoppflege und Trennung von Wald und Weide.
Baumarten und Holzvorrat im Bergwald

Wie die Bundeswaldinventur 2012 ergab, ist der Wald im Gebirge älter und hat größere Vorräte je Hektar als Wald im Flachland. Mit einem Anteil von 68 Prozent herrschen im Bergwald die Nadelbaumarten vor. Die Fichte, die im Alpenraum einen ihrer natürlichen Verbreitungsschwerpunkte hat, dominiert den Waldaufbau deutlich. Die Tanne rangiert an zweiter Stelle bei den Nadelbaumarten, gefolgt von der Kiefer. Lärchen und Zirben spielen in den bayerischen Alpen lediglich eine untergeordnete Rolle. Die vorherrschende Laubbaumart im bayerischen Alpenraum ist die Buche, gefolgt von Bergahorn und Esche, die beide zu den Edellaubbaumarten zählen. Ein kleiner Flächenanteil verteilt sich auf sonstige Laubbaumarten wie Vogelbeere, Mehlbeere, Erle, Birke und Weide.
Wegen der extremen klimatischen Bedingungen im Hochgebirge wachsen die Bäume in den Alpen wesentlich langsamer als im Flachland. Die Bergwälder sind mit durchschnittlich 101 Jahren älter als die Wälder im Flachland mit 83 Jahren. Mit rund 420 Vorratsfestmeter pro Hektar liegt der durchschnittliche Holzvorrat im Bergwald etwa sechs Prozent über dem bayerischen Landesmittel. Seit vielen Jahrzehnten liegt die Holznutzung deutlich unter dem Zuwachs.
Schutzfunktionen
Von den 260.000 Hektar Bergwald erfüllen rund 60 Prozent vorrangige Schutzfunktionen und sind durch das Waldgesetz für Bayern (BayWaldG) besonders geschützt. Die Erhaltung intakter Schutzwälder bzw. deren Wiederherstellung ist daher eine forstpolitische und gesellschaftspolitische Aufgabe von hohem Rang. Dazu ist es notwendig, die Berg- und Schutzwälder zu pflegen und zu bewirtschaften. Die vielfältigen Schutzfunktionen der Gebirgswälder werden von der Bayerischen Forstverwaltung im Rahmen der Waldfunktionsplanung erfasst und in Karten dargestellt.
50 Prozent der Waldfläche besondere Bedeutung für den Bodenschutz;
30 Prozent der Waldfläche besondere Bedeutung für den Lawinenschutz;
85 Prozent der Waldfläche sind Wildbacheinzugsgebiete.
Viele Waldflächen erfüllen sogar mehrere dieser Funktionen gleichzeitig.

Wälder festigen durch ihre intensive und tiefe Durchwurzelung den Boden und verhindern oder dämpfen zumindest Hangrutschungen und andere Erosionsvorgänge. Mischwälder mit einem hohen Tannen- und Laubbaumanteil können diese Bodenschutzfunktion besonders gut erfüllen. Fehlt das schützende Waldkleid, so hat dies neben der lokalen Gefährdung von Siedlungen, Verkehrswegen und Wiesen und Weiden auch einen erheblichen Einfluss auf die Stabilität des Gesamtökosystems. Ohne die bodenbildende und bodenhaltende Kraft des Waldes wären unsere Berge in Steillagen blanker Fels und Schutt.
Eine besondere Art des Bodenschutzes erfüllen die Steinschlagschutzwälder. Sie halten abrollende Steine und Felsbrocken zurück und haben eine große Bedeutung entlang vielbefahrener Alpenstraßen. Wälder mit hoher Stammzahl und dichtem Unterholz aus jungen Bäumen und Sträuchern können abrollende Steine besonders gut zurückhalten.

Im Lawinenschutzwald ist ein hoher Anteil an Fichten und Tannen von Vorteil, da deren Nadeln einen beträchtlichen Teil des frisch gefallenen Schnees in den Baumkronen festhalten. Nur geschlossene Wälder mit einer unregelmäßigen und ungleichartigen Struktur können den Lawinenschutz voll gewährleisten. Daher hat die ungestörte Entwicklung der Verjüngung entscheidende Bedeutung. Im Wald bläst der Wind weniger stark als auf Freiflächen. Durch die Windruhe kommt es seltener zu labilen und gleichförmigen Schneeansammlungen.
Oberhalb der Waldgrenze abbrechende Lawinen kann aber selbst ein intakter Schutzwald meist nicht auffangen. Die Schutzwirkung des Waldes liegt deshalb in seiner Fähigkeit, das Abgehen von Lawinen innerhalb des Waldes zu verhindern.
In den Bereichen des Schutzes und der Vorsorge vor Hochwasser kommt den Wäldern eine bedeutende Rolle zu. Das gilt für die Bergwälder in Wildbacheinzugsgebieten, wo der Hochwasserschutz beginnt, aber auch für die Wälder im Flachland, insbesondere für die flussbegleitenden Auwälder.

Wald wirkt auf den Wasserabfluss verzögernd und auf den Wasserhaushalt insgesamt ausgleichend. Bäume fangen in ihren Kronen die Niederschläge auf, die dort teilweise verdunsten und so gar nicht erst auf den Boden gelangen. Durch die Beschattung taut Schnee im Wald langsamer ab. Darüber hinaus verhindert der Wald Erosionsprozesse und vermindert damit die Gefahr, dass abgeschwemmte Feststoffe die Wildbäche verklausen und es zu Überschwemmungen kommt. Am besten erfüllen diesen Hochwasserschutz intakte Mischwälder mit einer intensiven Durchwurzelung des Bodens.
Große Wassermengen können naturnahe Auwälder speichern. Dort wird auch die Strömungsenergie des Wassers verringert. Natürliche Überschwemmungsflächen wie der Auwald stellen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die mit Abstand wirksamste Maßnahme zur Minderung von Hochwasser dar. Auch Moore sind ein wertvoller Bestandteil und wichtige regulierende Elemente im Wasserkreislauf. Daher kommt dem Erhalt und der Renaturierung der Moore seit Jahrzehnten eine hohe Bedeutung zu.
Weitere Informationen zum Hochwasserschutz:
 © StMELF
© StMELFGefahren für den Schutzwald

Große Temperaturschwankungen, hohe Schneelagen, heftige Stürme, Starkniederschläge und kräftige Sonnenstrahlung: Das sind einige der abiotischen Faktoren, mit denen die Berg- und Schutzwälder zurechtkommen müssen. Die Bedingungen im Gebirge sind in jeder Hinsicht extrem. Die Prognosen gehen davon aus, dass als Folge der Klimaveränderungen diese Extreme eher zu- als abnehmen werden. Dazu kommen biotische Gefahren, beispielsweise durch Borkenkäfer und Wildverbiss. Diese Umstände stellen große Herausforderungen für den Bergwald dar und können seine wichtigen Schutzfunktionen dauerhaft schwächen.
Schutzwaldpflege
Berg- und Schutzwälder erfüllen ihre vielfältigen Funktionen für das Gemeinwohl am besten, wenn sie sich aus standfesten, vitalen und widerstandsfähigen Bäumen zusammensetzen, die optimal an die mitunter extremen Wuchsbedingungen im Gebirge angepasst sind. Sich selbst überlassene Wälder können – trotz beachtlicher ökologischer Stabilität – Eigenschaften aufweisen, die ihre Schutzwirkung einschränken. Schutzwälder bedürfen deshalb teils intensiver Pflege. Sie fördert insbesondere stufige, ungleichaltrige und stabile Waldstrukturen, bei denen im Katastrophenfall die Verjüngung schon in den Startlöchern steht. Schutzwaldpflege begünstigt standortgemäße Mischbaumarten. Wo diese fehlen, werden sie auf dem Weg der Pflanzung eingebracht.
Schutzwaldpflege wird gefördert
Die Bewirtschaftung der Berg- und Schutzwälder ist wesentlich schwieriger und aufwändiger als im Flachland. Waldpflegemaßnahmen verursachen deshalb weit höhere Kosten. Aus diesem Grund unterstützt der Freistaat Bayern die privaten und kommunalen Waldbesitzer im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel über sein forstliches Förderprogramm seit Jahren bei der Schutzwaldpflege mit erhöhten Fördersätzen, um die Schutzfunktionen der Wälder zu erhalten oder zu verbessern.
Fördermöglichkeiten im Berg- und Schutzwald
Schutzwaldsanierung

Als sanierungsnotwenig gelten Schutzwälder, wenn ihre Funktionstauglichkeit deutlich gestört ist und diese im Rahmen der regulären Waldbewirtschaftung nicht wieder hergestellt werden kann. 1986 erhob die Bayerische Forstverwaltung den Zustand der Schutzwälder in allen Waldbesitzarten und leitete daraus eine langfristige Gesamtplanung für die Schutzwaldsanierung im bayerischen Alpenraum ab. Seither wird der Plan in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben und den neuesten Erkenntnissen angepasst.
Weitere Informationen zur Schutzwaldsanierung:
Jagd im Gebirge

Bayerns Bergwälder sind Lebensraum für die Schalenwildarten Rot-, Reh- und Gamswild sowie zum Teil seltener Wildarten, die nicht bejagt werden. Trotz unterschiedlicher Ansprüche an ihren Lebensraum überlappen sich deren Habitate vor allem im Waldbereich. Um Wildschäden in sensiblen Schutzwaldlagen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, muss beim Jagdmanagement konsequent auf angepasste Wildbestände der drei Schalenwildarten hingewirkt werden.
Weitere Informationen zu Jagd und Wild im Gebirge:
Waldweide

Die meisten der heutigen Weiderechte in den bayerischen Alpen wurden Anfang des 19. Jahrhunderts nach der Säkularisation des Kircheneigentums festgeschrieben. Als im April 1958 das Gesetz über die Forstrechte in Bayern in Kraft trat, waren rund 120.000 Hektar Bergwald in Oberbayern mit Weiderechten belastet. Dies entsprach in etwa zwei Drittel der Staatswaldfläche, auf der sich die Mehrzahl der Weiderechte konzentrierte. In den letzten Jahrzehnten ist es gelungen, auf mehr als der Hälfte der ehemals weiderechtsbelasteten Fläche in den bayerischen Alpen Wald und Weide zu trennen. Heute existieren im bayerischen Staatswald noch auf etwa 50.000 Hektar Weiderechte mit Schwerpunkt in den oberbayerischen Alpen. Auf rund der Hälfte dieser Fläche wird die Waldweide noch aktiv ausgeübt. Gleichzeitig konnte die Zahl der aufgetriebenen Tiere verringert und somit die Waldbestände entlastet werden.
Erhalt der traditionellen Bewirtschaftung unserer Almen durch leistungs- und zukunftsfähige landwirtschaftliche Betriebe
Entlastung insbesondere des Schutzwaldes von landeskulturell nachteiligen Waldweiderechten
Politische Aktivitäten rund um den Bergwald
Der Bergwaldbeschluss des Bayerischen Landtages vom 5. Juni 1984 war richtungsweisend und stellt auch heute noch den Rahmen für den Erhalt und die Pflege der Bergwälder im Freistaat dar. Der Landtag macht darin unter anderem Vorgaben zur Information der Bevölkerung über die Bedeutung des Bergwaldes, zu seiner Bewirtschaftung und zu angepassten Schalenwildbeständen. Ferner legt er darin den Grundstein für die Schutzwaldsanierung.
Bayerischer Landtag/10. Wahlperiode - Drucksache 10/3978 vom 05.06.84
Zwei Jahre später, am 11. Juni 1986, beschloss der Bayerische Landtag einstimmig, den Zustand der Schutzwälder zu erfassen, das Gefährdungspotenzial zu ermitteln und erforderlichenfalls festgestellte Defizite zu beheben. Dies markiert die Geburtsstunde der Schutzwaldsanierung in Bayern.
Bayerischer Landtag/10. Wahlperiode - Drucksache 10/10487 vom 11.06.86
Am 4. Februar 2015 wurden im Bayerischen Landtag Experten zu Aufgaben, zu Gefährdungen und zum Zustand der Bergwälder angehört. Parlamentarier und Fachleute waren sich einig, dass ein intakter Bergwald mehr denn je unverzichtbar für den bayerischen Alpenraum ist und vor Schädigungen geschützt werden muss.
Wälder und Waldbesitzer werden vom Klimawandel stark betroffen, obwohl sie umgekehrt sehr viel zum Klimaschutz beitragen. Dies gilt ganz besonders für den Alpenraum. Deshalb engagieren sich der Freistaat Bayern für die aktive zielgerichtete Anpassung der Bergwälder, aber auch für die Stärkung und wirtschaftliche Weiterentwicklung des Forstsektors im Alpenraum. Hierfür sind Anstrengungen auf allen Ebenen erforderlich.
In der gemeinsam von Bayern, Österreich, Südtirol, Tirol und Trient aufgestellten Bergwaldagenda werden die wichtigsten Herausforderungen, Leitlinien und Handlungsfelder beschrieben. Für die Zukunft sehen die Unterzeichner deutlich mehr als bisher auch die europäische Ebene gefordert.
Die Alpenkonvention vom 7. November 1991 ist ein völkerrechtlicher Vertrag über den umfassenden Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Alpen. Unterzeichner sind neben der Bundesrepublik Deutschland alle weiteren sieben Alpenstaaten und die Europäische Union. Das Bergwaldprotokoll aus dem Jahr 1994 regelt die Umsetzung der Ziele der Alpenkonvention im Bereich der Berg- und Schutzwälder. Viele politische Dokumente wie beispielsweise der Aktionsplan zum Klimawandel äußern sich zum Bergwald. Zu den Gremien der Alpenkonvention gehört seit 2013 auch eine Arbeitsgruppe Bergwald, in der auch Vertreter aus Bayern aktiv mitwirken.
www.alpconv.org/de externer LinkIn der Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer (Arge Alp) bündeln der Freistaat Bayern und neun weitere Alpenregionen ihre Aktivitäten, um gemeinsam den Alpenschutz voranzutreiben. Der Bergwald spielt dabei unter anderem im gemeinsamen Projekt "Ökologie und Ökonomie im Schutzwald" eine wesentliche Rolle.
www.argealp.org externer LinkDie EU-Kommission beschloss am 28. Juli 2015 auf Initiative Bayerns und weiterer Alpenregionen die Alpenstrategie der Europäischen Union (EUSALP). Neu an dem gemeinsamen Aktionsplan sind die Konzentration auf ökonomische und ökologische Schwerpunkte sowie der so genannte Multi-Level-Governance-Ansatz: Eine Strategie – sieben Alpenstaaten –48 Regionen. Wald und Forstwirtschaft sind auch in dieser Strategie ein wichtiger Baustein für Wirtschaftswachstum und Innovation, Schutz vor Naturgefahren, wie auch für Umwelt und Energie.
Das Förderprogramm INTERREG ist ein wirksames Instrument der Europäischen Union zur Finanzierung von grenzüberschreitenden oder transnationalen Projekten. Es stärkt die Verwirklichung und Umsetzung politischer Prozesse – auch und gerade im Bergwald.
www.alpine-space.eu externer LinkWasserschutzgebiete in Bayerns Wäldern
Überdurchschnittlich viele Wasserschutzgebiete liegen in Bayern in Wäldern. Insgesamt sind es annähernd zwei Drittel der Wasserschutzgebiets-Flächen oder rund 140.000 Hektar. Zum Vergleich: Der Anteil der Waldflächen an der Gesamtfläche Bayerns liegt nur bei gut einem Drittel (36 Prozent). Das zeigt, welche positive Wirkung der Wald auf unser Grundwasser hat.
Während die Schwefelbelastung der Wälder rückläufig ist, ist beim Stickstoff keine Abnahme der atmosphärischen Einträge zu erkennen, wie die Daten der bayerischen Waldklimastationen zeigen. Gleichzeitig wird aber ein geringerer Stickstoffaustrag beobachtet. Diese Messergebnisse legen den Schluss nahe, dass die Waldböden noch über Speicherkapazitäten verfügen. Auch die Ergebnisse der Anfang der 2000er durchgeführten Bayerischen Nitratinventur und der fünf Jahre später erfolgten zweiten Bodenzustandserhebung (BZE II) bestätigen das. Die flächenrepräsentativen Untersuchungen zeigten, dass die Wälder noch in der Lage sind, Stickstoff im Ökosystem zurückzuhalten.
LWF-aktuell 66: Gutes Wasser aus dem Wald? - Trinkwasser aus dem Wald externer LinkIhre Ansprechpartner
Bei Fragen rund um den Berg- und Schutzwald, zur Schutzwaldsanierung oder zu Wasserschutzgebieten in Bayern stehen Ihnen die Försterinnen und Förster der Bayerischen Forstverwaltung jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
Weitere Informationen
Digitaler Baumexperte im Waldbesitzer-Portal