
Ausgabe November/Dezember 2025 – Themen
Mitarbeitergespräche sollen dazu beitragen, einen partnerschaftlichen und vertrauensvollen Dialog zwischen der Führungskraft und seinen Mitarbeitern zu unterstützen. Auf der Basis eines gemeinsamen Rückblicks zum Jahresende sollten möglichst auf Augenhöhe Ziele für ein gedeihliches Miteinander und Arbeitsziele für das kommende Jahr festgelegt werden. "Reden miteinander statt übereinander", so lautet das Motto des – Dialogformates "Grüne Couch" in Stadt und Landkreis Ansbach. Entsprechende Veranstaltungen sind Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach, die seit März 2023 durchgeführt werden und deren Wirkungskreis zum Teil deutlich über die Grenzen des Dienstgebietes hinaus reichte. Effizienzsteigerung und Aktualität – das waren die Schlagworte, als vor elf Jahren die Weichen für das heutige Portal für Lehrkräfte gestellt wurden. Auslöser war eine klare Ansage: Die Unterrichtsvorbereitung an den Landwirtschaftsschulen in Bayern kostete zu viel wertvolle Zeit. Die digitale Lösung in Form des Lehrerportals ist ein Erfolgsmodell. Gesundheit, Lebensfreude, Wohlbefinden und Selbstständigkeit bis ins hohe Alter durch ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung erhalten: Das "Netzwerk Generation 55plus – Ernährung und Bewegung", initiiert vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, fördert diese Faktoren bayernweit durch vielfältige Angebote.
Schule und Beratung - Heft 11-12/2025 (PDF) Downloadlink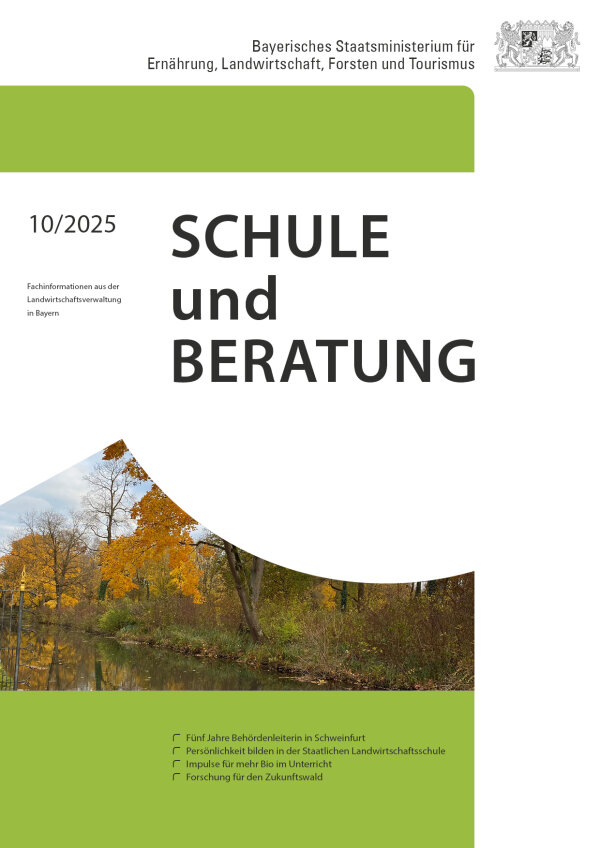
Ausgabe Oktober 2025 – Themen
Das Interview mit der Behördenleiterin Klaudia Schwarz beleuchtet verschiedene Themenbereiche: Von der Entwicklung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt über den persönlichen Werdegang bis zu Fragen zu Softskills und zur Frage zu einem weiblichen Führungsstil. Als Angebot für die Studierenden in Uffenheim hat sich das eintägige Seminar "Leben und Arbeiten" zum Ende des 3. Semesters etabliert. Die Studierenden setzen sich mit ihrer jetzigen und zukünftigen Situation, aber auch mit Privatleben sowie Berufsleben auseinander. Mit diesem Seminar wird das Thema mentale Gesundheit weiter aus dem Schattendasein geholt. Das Seminar findet in Zusammenarbeit mit Maschinenring, Landwirtschaftlicher Familienberatung sowie Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau statt. Der ökologische Landbau soll ausgebaut werden, da diesem eine wichtige Rolle für eine nachhaltig ausgerichtete Landwirtschaft zugeschrieben wird. Dafür werden auf Bundes- und Länderebene verschiedene Maßnahmen ergriffen wie die stärkere Integration von Inhalten zum Thema Bio in der beruflichen Bildung. Gut aufbereitete Materialien und Arbeitsblätter für den Unterricht machen es einfach, Bio ins Klassenzimmer zu bringen. Die Bildungsoffensive Ökolandbau hat einen Blick in andere Bundesländer gewagt und stellt einige attraktive Angebote für Lehrkräfte vor. Trockenheit, Dürre, Extremwetter und Schadorganismen machen unseren Wäldern und den Ökosystemen zu schaffen. In der Vision der Ressortforschung des Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus stellt der Erhalt und die Förderung von Biodiversität im Klimawandel daher einen zentralen Punkt dar. Der integrative Ansatz für die Waldbewirtschaftung, der auch in der praxisnahen Forschung Niederschlag findet, beschreibt den bayerischen Weg einer nachhaltigen, naturnah und pfleglich betriebenen Forstwirtschaft auf der ganzen Fläche mit dem Leitmotiv "Schützen und Nutzen".
Schule und Beratung - Heft 10/2025 (PDF, barrierearm) Downloadlink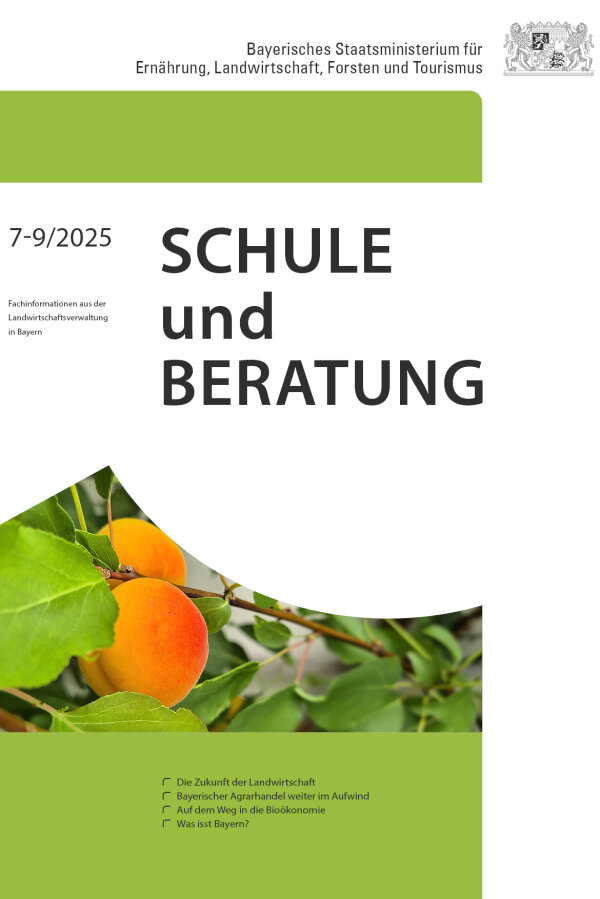
Ausgabe Juli/September 2025 – Themen
Die Jahrestagung 2025 der europäischen Netzwerke ländlicher Beraterinnen und Berater von IALB (Internationale Akademie für ländliche Beratung), EUFRAS (European Forum for Rural Advisory Services) und SEASN (South East European Rural Advisory Services Network) in Brüssel stand unter dem Motto "Die Rolle von Beratung und Bildung in der GAP jetzt und in Zukunft stärken". Über 150 Fachleute aus Beratung, Bildung, Politik und Praxis aus 22 Ländern diskutierten zur aktuellen und zukünftigen Rolle der ländlichen Beratungsdienste im Hinblick auf die Zukunft der Agrarberatung im Kontext der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ab 2028. Die Tagung wurde vom Freistaat Bayern in Zusammenarbeit mit seiner Vertretung bei der EU in Brüssel durchgeführt. Die bayerische Agrar- und Ernährungswirtschaft erreicht im Jahr 2024 neue Höchstwerte im Außenhandel. Die Exporte belaufen sich auf 12,64 Milliarden Euro. Die Importe liegen mit 13,78 Milliarden Euro leicht darüber. Käse bleibt das wichtigste Exportgut (2,28 Mrd. Euro), gefolgt von pflanzlichen Nahrungsmitteln a.n.g. (1,63 Mrd. Euro) und Milchprodukten (1,42 Mrd. Euro). Italien ist der größte Abnehmer bayerischer Ernährungsgüter, während Österreich der wichtigste Lieferant bleibt. Beim Handel mit den EU-Ländern, der knapp 80 Prozent am Gesamthandel ausmacht, verzeichnet die bayerische Ernährungswirtschaft nach wie vor einen Importüberschuss. Im Drittlandhandel hingegen erzielen bayerische Agrargüter einen Exportüberschuss. Vor allem die Exporte in das Vereinigte Königreich und nach China steigen überproportional. Die Bayerische Bioökonomiestrategie Zukunft.Bioökonomie.Bayern zeigt den Weg von einer Wirtschaft mit fossilen Rohstoffen hin zu einer nachhaltigen und biobasierten Wirtschaftsweise. Sie bildet die Grundlage für diesen strukturellen Wandel. Im Fokus stehen ökologische Verantwortung, soziale Gerechtigkeit sowie der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen und der Erhalt der Biodiversität. Nahrungs- und Futtermittelproduktion, Bioenergie sowie stoffliche Nutzung sollen sich dabei ergänzen. Eine zentrale Rolle fällt dabei der Landwirtschaft zu: Sie kann einen Teil der notwendigen nachwachsenden Ressourcen liefern. Auf Social Media finden sich täglich neue Ernährungstrends und -tipps. Doch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) wollte es genau wissen: Was Essen die Bürger wirklich? Wieviel Gemüse, Fleisch und Brot? Gibt es Hinweise auf kritische Nährstoffe? Um Antworten darauf zu erhalten, hat das Kompetenzzentrum für Ernährung gemeinsam mit wissenschaftlichen Partnern die Bayerische Ernährungsstudie durchgeführt. Und die Ergebnisse zeigen, dass sich in den letzten 20 Jahren vieles bewegt hat.
Schule und Beratung - Heft 7-9/2025 (PDF, barrierearm) Downloadlink
Ausgabe Mai/Juni 2025 – Themen
Rapsölkraftstoff kann in der Landwirtschaft regional erzeugt werden, gilt als krisensicher und umweltfreundlich. Im Rahmen des internationalen Verbundvorhabens ResiTrac untersucht das Technologie- und Förderzentrum einen Traktor der Abgasstufe V mit Rapsölkraftstoff beim Pflügen. Wie schneiden Traktor und Kraftstoff im Abgastest unter Realbedingungen ab? Kaum spitzen im Frühjahr zaghaft die ersten Blätter des Bärlauchs aus dem Waldboden, werden sie von begeisterten Genießern gepflückt. Auch die einschlägigen Medien folgen dem Rummel um das würzige Frühlingskraut mit dem knoblauchartigen Geschmack. Doch unbeachtet wächst zur gleichen Zeit in schattigen Ecken ein wahres Superkraut heran, das für bärlauchverwöhnte Zungen das gleiche Geschmackserlebnis bietet – die Knoblauchsrauke (Allaria petiolata). Anlässlich des Waldpädagogiksymposiums "Wald.Bildet.Zukunft" am Walderlebniszentrum Grafrath stellte Staatsministerin Michaela Kaniber die neueste Auflage des waldpädagogischen Leitfadens "Forstliche Bildungsarbeit" vor. Er enthält über 340 Anleitungen für praktische Aktivitäten und Experimente zu allen Themenfeldern rund um den Wald. Erfahren Sie, wie es gelingen konnte, dass ein (in erster Auflage) grauer Behördenordner zum beliebten Waldkompendium wurde, ein bayerischer Exportschlager mit einer deutschsprachigen Auflage von bislang 30 000 Exemplaren und Übersetzungen in zehn Sprachen. Das "20 km Dinner" im Februar 2025 im Klosterbräustüberl Furth bei Landshut war eine echte Win-Win-Situation für alle Beteiligten – die Genussregion Niederbayern am Amt für ländliche Entwicklung Niederbayern, die Staatliche Landwirtschaftsschule Landshut, Abteilung Hauswirtschaft, die Direktvermarkter und die Besucher. "20 km Dinner" ist ein kulinarischer Menüabend, bei dem die Hauptzutaten aus einem Umkreis von 20 km um den Veranstaltungsort stammen.
Schule und Beratung - Heft 5-6/2025 (PDF, barrierearm) Downloadlink
Ausgabe März/April 2025 – Themen
Die Beratung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Traunstein ist sehr gefragt, da sie auf die speziellen Anforderungen der Milchviehhaltung im Voralpenraum zugeschnitten ist. Die standardisierten Abläufe und die Erfahrung der Berater ermöglichen eine effiziente Betriebsanalyse. Die Protokollierung der Beratungsgespräche fördert die Nachvollziehbarkeit. Die Beratung berücksichtigt die Familienstruktur der Betriebe, die für die Entscheidungsfindung wichtig ist. Langjährige Buchführungsauswertungen bieten eine solide Datenbasis für zielgerichtete Beratungen. Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau hat den Einsatz eines kompakten Hackroboters in einer Obstbaumschule im Landkreis Forchheim erprobt. Die Versuchshintergründe waren zum einen die Herbizideinschränkungen, zum anderen der Mangel an Saisonarbeitskräften und die steigenden Löhne. Es sollte neben der Funktionalität des Roboters auch die Wirtschaftlichkeit geprüft werden. Es sollte zudem bewertet werden, wie sich die Engpflanzung auf das Wachstum und die Qualität der Bäume auswirkt. Die Fläche wurde ökologisch bewirtschaftet. Stellen Sie sich vor, Sie genießen einen sonnigen Wandertag im Wald, als plötzlich eine Absperrung Ihren Weg versperrt. Ein Banner mit alarmierenden Warnungen sorgt für Unmut und Frustration. Wie kann man solche kritischen Situationen entschärfen und das Verständnis der Öffentlichkeit gewinnen? In unserem Beitrag erfahren Sie, wie effektive Baustellenkommunikation, unterstützt durch innovative Hinweisschilder und Banner, dazu beitragen kann, die Akzeptanz forstwirtschaftlicher Maßnahmen zu steigern und Proteste zu vermeiden. Immer wieder kündigt US-Präsident Trump Zollerhöhungen für Waren aus der EU an. Die wichtigsten Exportgüter der bayerischen und deutschen Ernährungswirtschaft (z. B. Fleisch und Fleischwaren, Backwaren, Milch und Käse) wären von US-Zöllen nur geringfügig betroffen, da diese größtenteils in die EU exportiert werden. Größere Auswirkungen wären jedoch für die Getränkeindustrie zu erwarten, in der landwirtschaftlichen Produktion insbesondere für die Hopfenbaubetriebe.
Schule und Beratung - Heft 3-4/2025 (PDF, barrierearm) Downloadlink
Ausgabe Januar/Februar 2025 – Themen
Im Rahmen des Projekts MasterGras wurde ein innovatives Tool entwickelt, das mittels KI-Einsatz und Satellitentechnologie zukünftig als permanenter Service im Grünland genutzt wird. Dem Ressort stehen damit Informationen für das gesamte bayerische Grünland hinsichtlich Schnitt- und Ertragsdaten nahezu in Echtzeit zur Verfügung, wodurch Beratung effizienter und zielgerichteter gestaltet werden kann. Auf dem Gelände der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Bamberg fand Ende 2024 der alljährliche Azubitag zum Netzwerken im Ökogartenbau statt. Das kompetenzzentrum Ökogartenbau organisierte die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern e. V. (LVÖ). Rund 45 Auszubildende aus den verschiedenen Fachsparten des Produktionsgartenbaus nahmen teil und erlebten zwei Tage voller Austausch, Praxis und Einblicke in die Vielfalt des ökologischen Gartenbaus. Bisher werden Kühl- und Gefriergeräte mit herkömmlichen Isoliermaterialien aus erdölbasiertem Polyurethan-Schaum gedämmt. Die Weltneuheit BluRoX benutzt zur Isolierung stattdessen ein Vakuum in Verbindung mit fein gemahlenem Perlit. Das Lavagestein Perlit hat aufgrund seiner kristallinen Mikrostruktur eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und das Vakuum bietet energietechnisch die bestmögliche Isolierung. Futtermittelzukauf ist die Hauptquelle der Stickstoff- und Phosphor-Zufuhr in bayerischen Rinderbetrieben. Eine Verringerung von N- und P-Emissionen kann durch optimierte Futterrationen in der Rinderhaltung sowie einen angepassten Mineraldüngereinsatz erfolgen. Die Optimierung der Futterwirtschaft sowie individuelle Futteranalysen, exakte Rationsberechnungen, der Einsatz moderner Fütterungstechnik und eine regelmäßige Rationsüberwachung sind die wichtigsten Stellschrauben in tierhaltenden Betrieben.
Schule und Beratung - Heft 1-2/2025 (PDF, barrierearm) Downloadlink
Ausgabe November/Dezember 2024 – Themen
Das Schwenden ist eine wichtige Pflegemaßnahme, um die Almweiden von Bäumen, Sträuchern, Disteln und Farnen freizuhalten. Somit kann die Verdrängung von hochwertigen Futtergräsern sowie Kräutern verhindert werden, und die wertvolle Kulturlandschaft der Almen bleibt erhalten. Die Studierenden der Staatlichen Landwirtschaftsschule Holzkirchen lernten im Rahmen eines Almschultages auf der Niederhofer Alm in Bayrischzell die wesentlichen Maßnahmen zur fachgerechten Almbewirtschaftung kennen und führten eigenständig verschiedene Pflegemaßnahmen durch. Der Asiatische Moschusbockkäfer stellt Behörden in Bayern und Italien vor große Herausforderungen. Bei einem Austausch italienischer Fachkollegen mit allen Beteiligten der bayerischen Forst- und Landwirtschaftsverwaltung wurde der Umgang mit dem gefährlichen Quarantäneschädling beleuchtet. Es gab viele wertvolle Impulse dazu, wie durch Monitoring, Aufklärung und internationale Zusammenarbeit Maßnahmen zur Eindämmung entwickelt werden können, um wirtschaftliche Schäden zu minimieren und Akzeptanz bei der Bevölkerung zu erreichen. Die Gründe für Bio sind vielfältig, genauso wie die Wege und Partnerschaften. Die Bäckerei Wolz und das Gut Obbach arbeiten seit Jahrzehnten eng zusammen. Im Gespräch sind der Bäckereiinhaber und die Gutsverwalter darauf eingegangen, wie das gelingen kann. Franziska Weiß von der Ökopakt-Vernetzungsstelle und Sophia Weisensee vom BioRegio Betriebsnetz haben die Bäckerei mit Bio-Teilsortiment und den landwirtschaftlichen Bio-Betrieb in Unterfranken besucht. Die Welt des Weines besteht aus unbegrenzten Möglichkeiten. In diesem Sinne haben 15 angehende Weinbautechniker im Rahmen ihres Abschlussjahres an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim ein einzigartiges Projekt ins Leben gerufen: das Schülerweinprojekt "Alles Rot".
Schule und Beratung - Heft 11-12/2024 (PDF, barrierearm) Downloadlink
Ausgabe September/Oktober 2024 – Themen
Unter dem Motto „Einfach schafft Mehrwert – Gemeinsam für eine schlankere Bürokratie“ hat das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus in Bayern einen einzigartigen Prozess gestartet. Den Auftakt dieses Prozesses bildete die größte Online-Umfrage in der Geschichte des Ministeriums mit 13 775 verwertbaren Rückantworten. Ziel war es, Einblicke in aufwendige Förderbereiche und belastende Dokumentationspflichten zu gewinnen sowie praxisnahe Vorschläge zur Bürokratieerleichterung zu sammeln. Ein sektorübergreifender Vergleich der genannten Belastungen mit anderen Wirtschaftssektoren stellt diese in einen breiteren Kontext. Die Wasserpaktpartner der Oberpfalz trafen sich im Juli 2024 am Knöblinger Bach zum jährlichen Austausch auf Einladung der Regierung der Oberpfalz. Der Wasserpakt Bayern vereint Verwaltungen, Verbände und Landwirte im Einsatz für sauberes Wasser. Bei einem Treffen in der Oberpfalz diskutierten Experten und Akteure aus der Wasserwirtschaft und Landwirtschaft über aktuelle Herausforderungen und Lösungen für den Gewässerschutz. Fachvorträge boten Einblicke in rechtliche Rahmenbedingungen und praktische Schutzmaßnahmen, während eindrucksvolle Maschinenvorführungen moderne Technologien zur Reduzierung von Düngemittel- und Pflanzenschutzeinträgen präsentierten. Das Treffen verdeutlichte, wie durch Kooperation und technische Innovationen der Schutz von Wasserressourcen vorangetrieben wird. Gehölze leiden unter Sonneneinstrahlung von zehn Stunden und länger, der Bewässerungsbedarf steigt stetig, nicht nur Mensch und Tier lechzen nach etwas Kühle und Schatten. Gleichzeitig steigt der Energiebedarf, während wir klimaneutral werden müssen. Dazu tragen regenerative Energien bei, doch geraten einige zunehmend in Konkurrenz mit landwirtschaftlicher Nutzfläche. Agri-Photovoltaik will beides zu beiderseitigem Nutzen kombinieren. Teil 1 gibt einen Überblick bestehender Systeme und Anlagen, die bereits am Netz sind. In einer sich stetig digitalisierenden Welt gewinnt der Einsatz moderner Technologien in der Bildung zunehmend an Bedeutung. Besonders in der landwirtschaftlichen Ausbildung, die traditionell stark praxisorientiert ist, bieten digitale Ansätze neue, spannende Möglichkeiten, die Zusammenarbeit zu stärken. Ein wegweisendes Beispiel hierfür ist das Projekt mehrerer Landwirtschaftsschulen – initiiert durch das Referat A3 des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus. Es führt abwechselnd digitale Live-Übertragungen von landwirtschaftlichen Betrieben für alle beteiligten Schulen durch und ermöglicht so eine breite Wissensvermittlung. Diese Initiative stellt einen wichtigen Schritt dar, um die Didaktik in der Landwirtschaftsausbildung zu modernisieren und den Lernenden eine praxisnahe, interaktive und zeitgemäße Lernerfahrung mit einheitlichem hohem Standard zu bieten.
Schule und Beratung - Heft 9-10/2024 (PDF, barrierearm) Downloadlink
Ausgabe Juli/August 2024 – Themen
Um den wachsenden Herausforderungen in der bayerischen Landwirtschaft zu begegnen, setzt Staatsministerin Kaniber ab Herbst 2024 ein umfassendes Maßnahmenpaket an den Staatlichen Landwirtschaftsschulen um. Es umfasst mehr Unterrichtsstunden in Pflanzenbau und Tierhaltung, intensiveres Kommunikationstraining und umfangreichere Rückmeldungen zur Wirtschafterarbeit. Zusätzlich werden neue Meistermodule eingeführt und die Vernetzung mit der Höheren Landbauschule gestärkt. Diese Maßnahmen gewährleisten eine zukunftsorientierte und praxisnahe Fortbildung in der Landwirtschaft. Rosi, ein Roboter aus der Werkstatt des Kemptener Startups Paltech, soll künftig zur Ampferbekämpfung eingesetzt werden. Eine Aufgabe, die bisher mit Herbiziden oder aber – beispielsweise auf Bio-Betrieben – mit langwieriger körperlicher Arbeit einhergeht. Ihr Entwickler Felix Schiegg und sein Team haben Rosi heute mitgebracht, um sie im Rahmen eines Innovationsworkshops des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums den Studierenden der Staatlichen Landwirtschaftsschule Kempten (Allgäu) vorzustellen. Der russische Angriff auf die Ukraine hat neben der humanitären Katastrophe auch Auswirkungen auf die globalen Warenströme. Sowohl die Ukraine als auch Russland sind wichtige Getreideexporteure auf dem Weltmarkt. Nachdem Russland wichtige Schwarzmeerhäfen in der Ukraine blockiert hatte, erleichterte die Europäische Union (EU) ab Mai 2022 mit sogenannten Solidaritätskorridoren und der Aussetzung von Einfuhrzöllen den Handel mit ukrainischen Agrarprodukten. Dies führte zu einem deutlichen Anstieg der Importe von Getreide und Ölfrüchten aus der Ukraine in die EU, insbesondere in die EU-Anrainerstaaten der Ukraine. Ausschlaggebend für die bayerischen Erzeugerpreise ist dagegen nach wie vor die globale Versorgungslage. Sie ärgern sich über überhängende Hecken, Wespen oder wildes Wiesenwachstum? Daran ist die Biodiversität schuld – aber im besten Sinne! Sie sorgt für saubere Luft, fruchtbaren Boden und vielfältige Nahrung. Erfahren Sie aus der Sicht einer Biodiversitätsberaterin und Biologin, warum der Schutz der Artenvielfalt so wichtig für unser Überleben ist und wie sie unseren Alltag bereichert.
Schule und Beratung - Heft 7-8/2024 (PDF, barrierearm) Downloadlink
Ausgabe Mai/Juni 2024 – Themen
Bestände der mehrjährigen Energiepflanze Durchwachsene Silphie müssen irgendwann wieder aufgegeben werden. Im Projekt "SilphieGuide" wird untersucht, wie der Umbruch der Dauerkultur gelingt. Um nachfolgend eine Nitratauswaschung zu vermeiden, sind angepasste Strategien erforderlich. Es zeigte sich, dass durchwuchsfreie Bestände der Folgekultur im ersten Jahr nach dem Umbruch bei richtigem Vorgehen möglich sind. Seit 1991 veranstalten die Staatliche Landwirtschaftsschule Bayreuth-Münchberg und die Fachschule für Landwirtschaft Plauen jährlich einen gemeinsamen Projekttag. Das Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern zu stärken und den Horizont der Studierenden zu erweitern. In diesem Jahr führte die Exkursion die Studierenden nach Sachsen zur Agrargenossenschaft Theuma – Neuensalz eG, wo sie konkrete Lösungen für die Herausforderungen des Betriebes erarbeiteten. Der "Grüne Montagabend", eine digitale Veranstaltungsreihe organisiert von der Regierung von Mittelfranken in Zusammenarbeit mit den mittelfränkischen Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF), erreichte in nur wenigen Monaten zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte. Neben förderrechtlichen Themen wurde auch über speziellere Themen, wie zum Beispiel seelische Gesundheit, Umstellung auf Ökolandbau oder auch Erlebnis Bauernhof informiert. Die vor 20 Jahren das erste Mal in Europa gesichtete Asiatische Hornisse zeigt ihr Expansionspotenzial als invasive Art. Vermutlich eine einzige begattete Königin wurde eingeschleppt. Inzwischen werden europaweit mehrere tausend Nester im Jahr gefunden. Vor allem Imkerende warnen vor der Ausbreitung des Tieres und befürchten Beeinträchtigungen an ihren Völkern. Inzwischen gibt es aber auch Meldungen von Schäden in anderen landwirtschaftlichen Bereichen.
Schule und Beratung - Heft 5-6/2024 (PDF, barrierearm) Downloadlink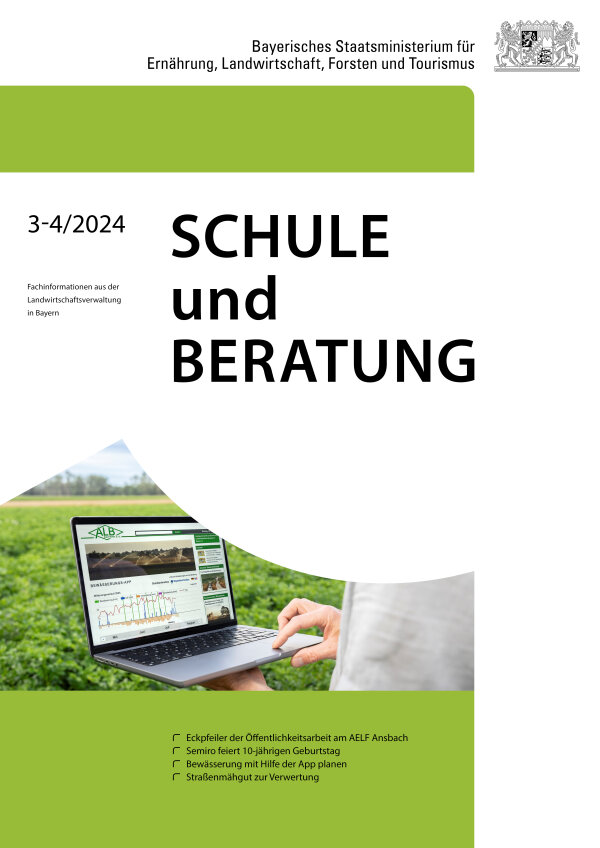
Ausgabe März/April 2024 – Themen
Im Zuge der Neuausrichtung der Landwirtschaftsverwaltung wurde an allen Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF) in Bayern eine Stelle "Presse & Kommunikation" geschaffen. Der vorliegende Beitrag ist ein Erfahrungsbericht des AELF Ansbach. Er gibt einen Einblick über die Organisation, ausgewählte aktuelle Arbeitsschwerpunkte und auch Einflussfaktoren einer bislang erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit vor Ort in Ansbach. In den letzten zehn Jahren hat sich die Software Semiro zu einem unverzichtbaren Werkzeug in zahlreichen Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF) entwickelt. Semiro ist ein Online-Buchungssystem, mit dem die Buchungen und die Verwaltung von Bildungsangeboten und Veranstaltungen abgewickelt werden. Der folgende Artikel gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Leistungsumfang der Software. Die Bewässerung soll das natürliche Wasserangebot aus Niederschlägen und pflanzenverfügbarem Bodenvorrat ergänzen. Die Bewässerungs-App der Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Landwirtschaftliches Bauwesen in Bayern e. V. (ALB) kann dabei unterstützen, dass dies bedarfsgerecht, angepasst an die Verteiltechnik, sparsam und damit effizient geschieht. Ökologische Mähkonzepte finden spätestens seit dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" immer stärkeren Einzug in die Pflege des öffentlichen Grüns. Statt die Flächen zu mulchen, soll das Mähgut abgeführt werden, was die Flächen abmagert und die Artenvielfalt auf Dauer erhöht. Eine vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus finanzierte Machbarkeitsstudie der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau betrachtete Verwertungswege, führte eine Potenzial- und Schadstoffuntersuchung von Straßenmähgut durch und erkannte die besondere Eignung von Kommunen für die Umsetzung..
Schule und Beratung - Heft 3-4/2024 (PDF, barrierearm) Downloadlink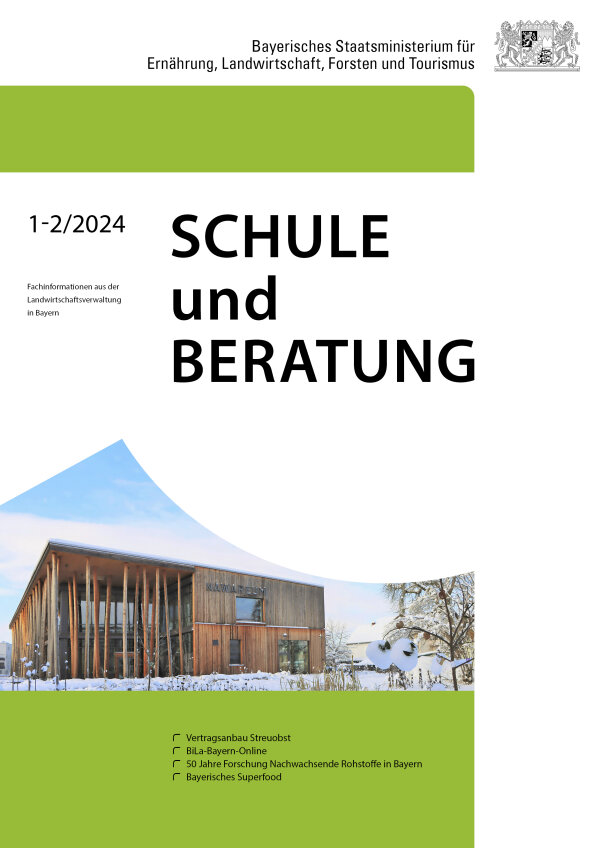
Ausgabe Januar/Februar 2024 – Themen
Ohne ein Mindestmaß an Wirtschaftlichkeit ist unser ökologisch wertvoller und landschaftsprägender Streuobstbestand in Bayern nicht zu halten. Welche Rolle dabei der Vertragsanbau spielen könnte, wird in einem Projekt der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau ergründet. Während der Corona-Pandemie musste eine große Anzahl an Modulen im Rahmen des Bildungsprogramm Landwirt-Angebotes kurzfristig online angeboten werden. Die Entwicklung dieses neuartigen digitalen Angebots sowie dessen Fortführung werden dargestellt. Mit einem zweitägigen Symposium zur Wissenschaftskommunikation feierte das Technologie- und Förderzentrum sein fünfzigjähriges Forschungsjubiläum in Straubing. Wie im Laufe des Symposiums deutlich wurde, gibt es ein großes gesellschaftliches Interesse an wissenschaftlichen Themen. Forschungseinrichtungen müssten allerdings stärker auf Verständlichkeit achten und sich mit Social Media auseinandersetzen, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Chiasamen, Acai- und Gojibeeren oder Moringa eroberten als Superfood die Supermärkte. Das aktuelle Kompendium des KErn "Bayerisches Superfood – Lokale Superhelden wiederentdeckt" hinterfragt den Trend und lenkt den Blick auf heimische Produkte, die zu Recht als Superfood bezeichnet werden können. Für sie sprechen vergleichbar hohe Nährstoffgehalte, Transparenz beim Anbau und kurze Transportwege. Die Inhalte des Kompendiums werden in einer Schulung nach dem Prinzip "Train the trainer" an die Kolleginnen der Ernährungsbildung an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vermittelt, die wiederum ihr Wissen an Multiplikatoren weitergeben.
Schule und Beratung - Heft 1-2/2024 (PDF, barrierearm) DownloadlinkDas Fachmagazin "Schule und Beratung" erscheint alle zwei Monate. Sollten Sie Interesse an einem Exemplar haben, wenden Sie sich bitte an die Redaktion.
Sollten Sie Interesse haben, einen Beitrag zu schreiben, wenden Sie sich bezüglich der Vorgaben an die Schriftleitung.
Redaktion
- Name:
- Dr. Anja Hensel-Lieberth Schriftleiterin von "Schule und Beratung"
- Adresse:
- Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Porschestraße 5 a 84030 Landshut
- Telefon:
- 0871 9522-0
- E-Mail:
- sub@fueak.bayern.de
- Internet:
- www.fueak.bayern.de externer Link
Breites Themenspektrum schafft Wissenstransfer
Dank des breiten Themenspektrums vom Ernährungsprojekt bis zur Wasserrahmenrichtlinie sorgt das Fachmagazin für einen enormen Wissenstransfer zwischen Staatsministerium, Landesanstalten und Ämtern. Wissenschaftliche Auswertung und Erfahrungsberichte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort halten Theorie und Praxis im Gleichgewicht.
Länderübergreifende Reichweite
Was ursprünglich als rein hausinterne Schrift des Staatsministeriums angelegt war, hat inzwischen auch einen großen Leserkreis weit über die Landwirtschaftsverwaltung hinaus, unter anderem bei Kollegen in anderen Bundesländern, in Österreich, der Schweiz und Südtirol.
